Viele Leser, Feuilletonisten und Branchenkenner vermuteten, dass Martin Walser mit Ein sterbender Mann (Der letzte Ausweg) bereits seinen literarischen Abschied verkündet hatte. Doch der Autor schien noch nicht die Ruhe für diesen neuen Lebensabschnitt gefunden zu haben und setzte sich unmittelbar nach der Veröffentlichung daran, seinem literarischen Lebenswerk ein weiteres Kapitel (dieses Mal vielleicht das letzte?) hinzuzufügen: „Nach einem Buch weiß man ja nie genau, was man tun soll. Und diesmal hat sich der Satz angeboten: »Mir geht es ein bisschen zu gut.« Das konnte ich dann so hinschreiben. Damit fing es an“, beschreibt er in einem Interview („Ich werde nie mehr solch eine Schreibfreude haben“) den Beginn des neuen Werkes. Herausgekommen ist Statt etwas oder Der letzte Rank, ein „Roman einer Selbstbefreiung“ (ebd.). Leider muss man konstatieren: Er hätte doch besser die Vermutungen bestätigt und Schluss gemacht mit dem Schreiben.
 Bereits vor dem ersten Kapitel schickt Walser vorweg, dass „Rank“ gemäß des Deutschen Grimmschen Wörterbuchs „wendung, die der verfolgte nimmt“ bedeutet. Der Autor möchte also anscheinend seinem Lebenswerk noch eine (letzte) Wendung geben. Ihm, beziehungsweise seinem Ich-Erzähler geht es also ein bisschen zu gut, eröffnet er – dem Leser geht es folgend allerdings alles andere als gut mit dem Roman. Sein Verlag beschreibt es als Werk „am Rand der Formlosigkeit“. Doch es folgt ein Konstrukt außerhalb von Prosa, sein Text ist nicht wirklich fassbar, lediglich deutbar. Er schreibt in einzelnen diffusen, zusammenhanglosen Episoden, zwischen Anekdoten und Belanglosigkeiten, außerhalb einer erkennbaren Zeitachse. Es ist vollkommen egal, ob man zwischendurch kurz abgelenkt ist oder einfach ein paar Zeilen, Seiten oder Kapitel überspringt – man kommt nie wirklich raus aus dem Erzähltem, man kommt nämlich erst gar nicht hinein in die „Geschichte“.
Bereits vor dem ersten Kapitel schickt Walser vorweg, dass „Rank“ gemäß des Deutschen Grimmschen Wörterbuchs „wendung, die der verfolgte nimmt“ bedeutet. Der Autor möchte also anscheinend seinem Lebenswerk noch eine (letzte) Wendung geben. Ihm, beziehungsweise seinem Ich-Erzähler geht es also ein bisschen zu gut, eröffnet er – dem Leser geht es folgend allerdings alles andere als gut mit dem Roman. Sein Verlag beschreibt es als Werk „am Rand der Formlosigkeit“. Doch es folgt ein Konstrukt außerhalb von Prosa, sein Text ist nicht wirklich fassbar, lediglich deutbar. Er schreibt in einzelnen diffusen, zusammenhanglosen Episoden, zwischen Anekdoten und Belanglosigkeiten, außerhalb einer erkennbaren Zeitachse. Es ist vollkommen egal, ob man zwischendurch kurz abgelenkt ist oder einfach ein paar Zeilen, Seiten oder Kapitel überspringt – man kommt nie wirklich raus aus dem Erzähltem, man kommt nämlich erst gar nicht hinein in die „Geschichte“.
Wenn ich dann selber weiter dachte, kam ich zu dem für mich nicht schmeichelhaften Ergebnis: Ich wäre mir unter allen Umständen zu eitel für ein Pseudonym. Meine Gedanken, das bin ich! Meine von ihr Hirngespinste genannten Versuche, das ist mein Exhibitionismus. Ich will erkannt sein! Und sei’s auf meine Kosten!
Klar, Martin Walser beherrscht das Spiel mit der Sprache, doch er kann dieses Können in diesem Fall einfach nicht kunstvoll zu Papier bringen. Es ist wie ein Gemälde, bei dem man nicht weiß, ob es als hochklassige Kunst oder das Werk eines Hobbymalers zu werten ist. Eine Handlung? Fehlanzeige! Es ist wie ein nicht enden wollender Monolog, den Walser einfach in unterschiedliche Perspektiven verpackt hat. Es spielt dabei schnell keine Rolle, wie viele autobiografische Elemente Walser verbaut hat, er lässt einfach dauerhaft die Selbstverliebtheit in die eigenen Fähigkeiten herausklingen. Kann das wirklich seine Absicht gewesen sein? Die Antwort ist viel erschreckender: Nein, es ist nicht seine Absicht, der Schönheit halber sein ganzes Können darzulegen; er möchte lediglich auf verschwurbelte Weise Kritik an seinen Kritikern üben, es ist eine einzige große Abrechnung. Und noch viel schlimmer: Es ist nicht die Selbstverliebtheit, die aus den Zeilen herauszulesen ist, es ist das Selbstmitleid („Und sie haben gedroht, wenn ich es weitersagte, würden sie das nächste Mal schlimmer mit mir umgehen als je. Tatsächlich war es schon bis jetzt jedes Mal schlimmer geworden.“ / „Es gibt innerhalb der bürgerlichen Welt keine Sprache für das, was sie mit mir machten, keine Paragraphen oder Ähnliches. Weder Verbote noch Lizenzen. Was sie mit mir machten, ist nicht in Klage oder Anklage unterzubringen.“). Hier fühlt sich jemand falsch verstanden, falsch behandelt und möchte einiges geraderücken: „Die Feinde waren deutlicher. Sie ließen keine Gelegenheit aus, mich herunterzumachen. Und wenn es keine Gelegenheit gab, schafften sie eine.“
Darum: Gefühlsfälschung als tägliche Beschäftigung. Ich kochte den Schmerz, die irdische Suppe! Wenn du nicht gewesen wärst, Sprache, hätte es mich nicht gegeben.
„Ich huste, also bin ich“, stellt der Erzähler in Abwandlung von Descartes erstem Grundsatz Cogito ergo sum („Ich denke, also bin ich“) fest, bis hin zur abschließenden Tautologie „Ich bin, also bin ich“. Doch dies sind noch die erträglichen Selbstbeweihräucherungspassagen. Richtig gruselig wird es, wenn Walser wieder einmal nicht widerstehen kann, seine schundliterarische Altherrenerotik unterzubringen: „Magdalenas Ausschnitt ließ den scharfen Schatten zwischen ihren Brüsten sehen. Alexandras Körper drängte überall gegen ihren Kleidungsglanz.“ / „Einmal bückte sich eine Frau bzw. ein Mädchen, eine Mädchenfrau also. In einem Dirndl, das sie ebenso schön bekleidete wie entblößte“ – abstoßende Trivialliteratur. Das Buch ist leider zu dünn, um es einem Sinn zuzuführen, beispielsweise hieraus Buchkunst zu gestalten. Doch man muss sich ernsthaft fragen: Was wäre wohl gewesen, hätte Martin Walser nach Ein sterbender Mann einfach den Stift beiseite gelegt und seinen schriftstellerischen Ruhestand genossen? Dann ginge es ihm sicherlich weiterhin „ein bisschen zu gut“ – und dem Leser zumindest ein bisschen besser als nach der Lektüre von Statt etwas oder Der letzte Rank.
Die literarische Hölle gibt es.
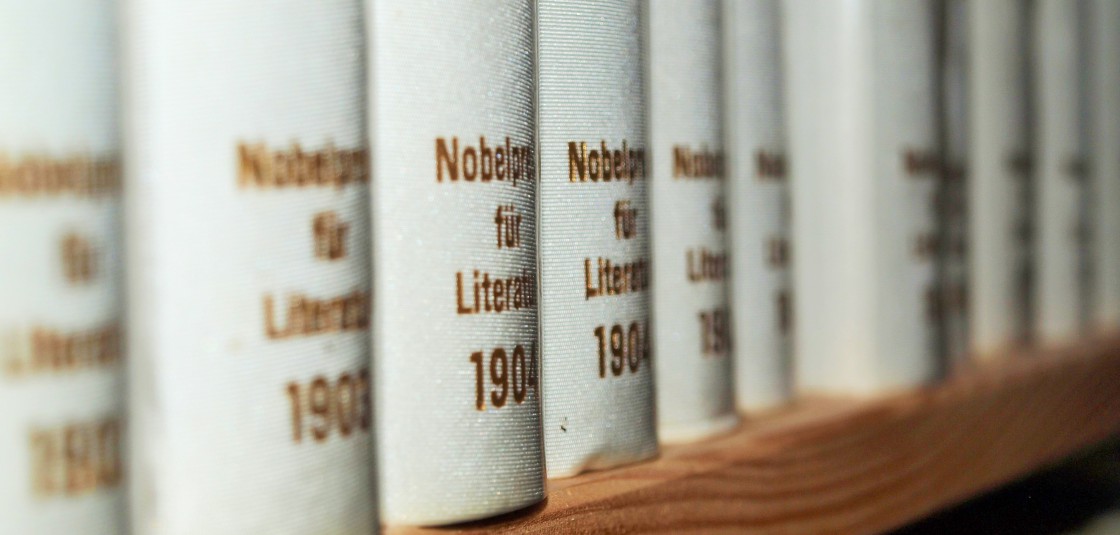

Pingback: Das Literarische Quartett: Die Sendung vom 3.März 2017 - Ein Kommentar